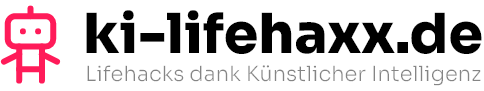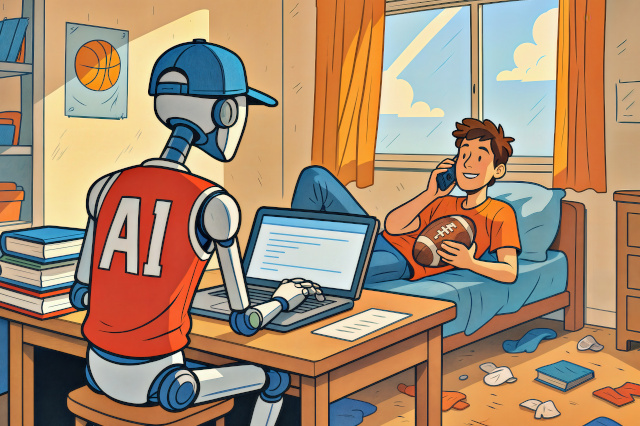Immer mehr Schülerinnen und Schüler nutzen Künstliche Intelligenz, um Schulaufgaben zu erledigen. Egal ob Referat, Aufsatz, Mathe-Hilfe oder Präsentation – Tools wie ChatGPT liefern in wenigen Sekunden Texte, Zusammenfassungen und scheinbar perfekte Antworten. Kein Wunder, dass KI für viele zu einem festen Bestandteil des Schulalltags geworden ist.
Aber: Nur weil ein Text gut klingt, heißt das noch lange nicht, dass er auch richtig ist. Die KI macht Fehler – und zwar öfter, als man denkt. Wer sie falsch einsetzt, riskiert schlechte Noten, peinliche Patzer oder einfach nur unnötige Missverständnisse.
Wie funktioniert KI eigentlich – und was macht sie anders als ein Mensch?
KI-Programme wie ChatGPT haben keinen Verstand, kein echtes Wissen und keine Meinung. Sie haben Millionen Texte gelesen, gelernt, welche Wörter häufig zusammen auftauchen, und erzeugen daraus neue Sätze. Das nennt man „Sprachmodell“.
Einfach gesagt: Die KI rät, welches Wort als Nächstes passt – basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Sie versteht dabei nicht, was sie da schreibt. Sie weiß auch nicht, ob es stimmt. Es geht nur darum, einen Text zu erzeugen, der so klingt, als hätte ihn ein Mensch geschrieben.
Deshalb ist die KI gut im Formulieren, aber nicht im Nachdenken, Hinterfragen oder Verstehen von Zusammenhängen.
Warum KI nicht immer richtig liegt – die häufigsten Ursachen
1. Veraltete Daten
Die meisten KIs haben einen festen Stand. ChatGPT kennt zum Beispiel nur Informationen bis Mitte 2024. Alles, was danach passiert ist – neue Gesetze, Entdeckungen, Ereignisse – kennt sie nicht.
Beispiel:
Du willst wissen, welche Länder 2025 neue Klimaziele beschlossen haben. Die KI listet dir Pläne von 2023 auf – weil sie von späteren Entwicklungen nichts weiß.
2. Quellenfehler
Die Texte, mit denen die KI trainiert wurde, stammen aus dem Internet. Darin stehen richtige Dinge – aber auch veraltete, falsche oder erfundene Informationen. Die KI kann das nicht unterscheiden.
Beispiel:
Früher wurde oft geschrieben, dass Napoleon klein gewesen sei. Tatsächlich war er für seine Zeit durchschnittlich groß. Trotzdem hält sich der Irrtum hartnäckig – und taucht auch in KI-Antworten auf.
3. Keine Rechenkompetenz
Bei komplexeren Matheaufgaben oder Sachaufgaben kommt die KI schnell an ihre Grenzen. Sie rechnet nicht wirklich – sie erstellt eine Art sprachlichen Rechenweg. Und der kann logisch falsch sein, auch wenn das Ergebnis stimmt.
Beispiel:
Fragt man nach dem Volumen einer Pyramide und gibt Maße ein, rechnet die KI manchmal mit der falschen Formel – weil sie den Zusammenhang nicht versteht.
4. Fehlender Kontext
Die KI weiß nicht, für wen sie schreibt. Sie kennt weder dein Unterrichtsthema noch die Ansprüche deiner Lehrkraft. Manchmal schreibt sie also völlig am Thema vorbei.
Beispiel:
Du sollst eine Gedichtanalyse zu Goethe schreiben. Die KI analysiert ein ganz anderes Gedicht – oder erfindet eines, das es gar nicht gibt.
Weitere Probleme, die in der Schule wirklich ärgerlich werden können
Fehlende Quellenangaben
Die KI nennt oft keine echten Quellen oder denkt sich welche aus. Wenn du z. B. nach einem Zitat fragst, bekommst du manchmal eine Quelle – aber die gibt es nicht wirklich.
Gefahr: Gibst du so etwas in einem Referat an, wirkt das unzuverlässig oder sogar wie Betrug – auch wenn du es nicht böse gemeint hast.
Plagiate und Copy-Paste-Probleme
Viele KI-Texte klingen glatt, aber unpersönlich. Wenn du sie 1:1 übernimmst, merkt deine Lehrkraft oft, dass der Stil nicht zu dir passt. Noch schlimmer: Manche Schulen sehen das als Plagiat – also als Abschreiben. Und das kann Ärger geben.
Falsche Begriffserklärungen
Besonders in Fächern wie Geschichte, Biologie oder Politik kommt es auf genaue Begriffe an. Die KI erklärt sie manchmal zu allgemein, zu kompliziert oder einfach falsch.
Beispiel:
Begriff „Demokratie“ – klingt simpel, aber die KI verwechselt manchmal direkte, parlamentarische und präsidentielle Systeme. Das wirkt in einer Klassenarbeit schnell wie Halbwissen.
Wie du KI trotzdem clever nutzt
Trotz aller Schwächen kannst du KI sinnvoll einsetzen – wenn du weißt, wie:
1. Hilfe holen, nicht alles blind übernehmen
Lass dir erklären, wie ein Thema funktioniert. Oder bitte die KI um eine Gliederung für ein Referat. Aber: Schreibe den Text selbst, in deinen eigenen Worten. So lernst du mehr – und es fällt nicht auf, dass er von der KI stammt.
2. Antworten immer prüfen
Glaub nicht alles, was die KI dir sagt. Vergleiche ihre Antworten mit deinem Schulbuch, Internetquellen (z. B. planet-wissen.de, lehrerfreund.de) oder frage jemanden, der sich auskennt.
3. Fragen konkret stellen
Je genauer du fragst, desto besser wird die Antwort. Statt „Was war im Zweiten Weltkrieg?“ lieber: „Warum griff Deutschland 1941 die Sowjetunion an?“
4. Eigene Beispiele einbauen
Die KI nennt oft allgemeine Beispiele, die nicht zu deinem Unterricht passen. Nimm lieber ein Beispiel aus deinem Heft, dem Unterricht oder deinem eigenen Alltag. Das zeigt, dass du selbst mitgedacht hast.
Fazit: KI ist ein Werkzeug – kein Ersatz fürs Denken
Künstliche Intelligenz kann dir viel Arbeit erleichtern – aber sie nimmt dir nicht das Denken ab. Wer alles blind übernimmt, macht Fehler, verpasst Lernchancen und riskiert schlechte Noten. Wer aber mitdenkt, nachprüft und selbst formuliert, kann von KI-Tools echt profitieren.